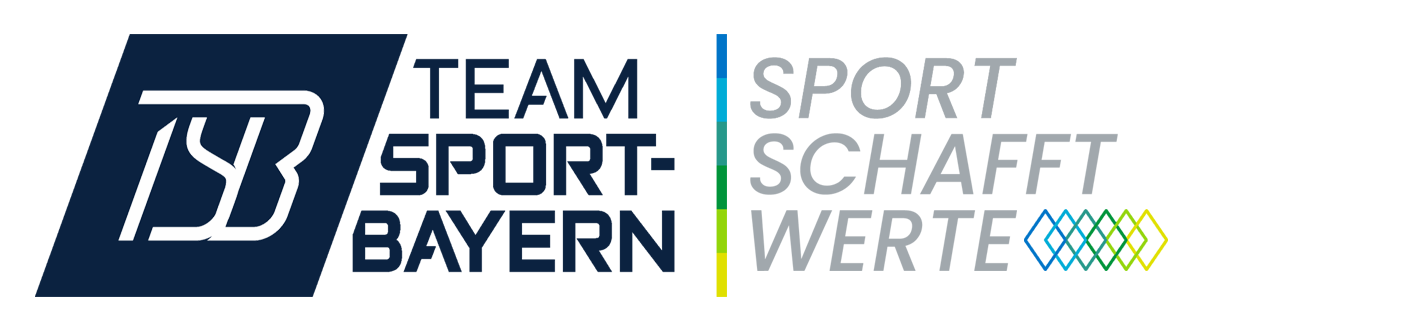Stefanie Hanke, Vizepräsidentin des Bayerischen Billardverbands und zuständig für die Organisation der Trainer/innenaus- und ‑fortbildung, entwickelte im Rahmen ihrer Ausbildung zur Demokratietrainerin eine Fortbildungseinheit zum Thema „Interkulturelles Lernen“. Ihr Praxisprojekt umfasst eine Vielzahl spielerischer Übungen, die Stereotype, Vorurteile sowie die Eigen- und Fremdwahrnehmung in den Mittelpunkt stellen.
Das Ziel: die interkulturelle Kompetenz von Trainer/innen nachhaltig stärken.
In einer immer diverser werdenden Gesellschaft spielt Interkulturelle Kompetenz eine entscheidende Rolle, auch und gerade im Sport. Denn Vereine sind nicht nur Orte der körperlichen Betätigung, sondern auch Räume, in denen Menschen unterschiedlicher Hintergründe aufeinandertreffen. Ziel des Praxisprojekts zur interkulturellen Kompetenz im Rahmen der Ausbildung zur Demokratietrainer/in war es, Trainer/innen durch praxisnahe Übungen zu befähigen, ein Bewusstsein für interkulturelle Dynamiken zu entwickeln und diese aktiv in ihre Trainingspraxis zu integrieren.
Den Weg dorthin ebneten für Stefanie Hanke vor vielen Jahre bereits persönliche Erfahrungen aus einem Freiwilligendienst, den sie zwischen Schule und Lehramtsstudium im Ausland absolviert hatte. Die Vorbereitungsseminare zur Entsendung hätten sie in die Welt des Perspektivwechsels ohne pädagogisch erhobenen Zeigefinger geführt. „Sie zeigten mir, dass interkulturelles Lernen gar nicht nur auf Begegnungen mit Menschen anderer Nationen anwendbar, sondern vielmehr in jeglichem Austausch mit anderen Menschen hilfreich sein kann, um deren Gedanken und Handlungen nachvollziehen zu können“, stellt Stefanie Hanke fest. Damit waren auch schon die Leitplanken gesetzt für ihr Praxisprojekt zur Interkulturellen Kompetenz.
Praktische Umsetzung des Projekts
Die Fortbildung wurde im Herbst 2024 für sechs bis 12 Teilnehmende konzipiert und umfasste fünf Lerneinheiten. Die angesprochene Zielgruppe bestand zumeist aus Männern mittleren Alters, die häufig schon seit Jahren Training in ihren Vereinen geben und im Fortbildungsbereich noch eher wenig Erfahrung mit sportartübergreifenden Themen haben. „Die Methoden zielen auf einen möglichst niedrigschwelligen und für die genannte Zielgruppe motivierenden Einstieg in das Thema Interkulturelles Lernen ab“, so die Autorin über ihren Ansatz.
Der besondere Fokus des Projekts lag auf interaktiven Übungen, die sowohl reflektive als auch handlungsorientierte Elemente enthielten – einschließlich vieler kleiner und großer Perspektivwechsel als Herausforderung und Überraschungsmoment. Auf eine aktive Einheit folgte nach der Reflexion meist ein thematisch passender Input, den die Teilnehmenden mit den gerade gemachten Erfahrungen abgleichen konnten. Auf diese Weise bekam der theoretische Input eine wesentlich höhere Relevanz für die Teilnehmer/innen und konnte längerfristig gemerkt werden. Die Abstraktheit der Übungen nahm Lauf des Lehrgangs zu.
Hier beispielhaft einige themenbezogene Übungen:
- Stereotype und Vorurteile
- Im „Telespiel“, einer Partnerübung, schätzten die Teilnehmenden Berufe, Hobbys und Eigenschaften ihres Gegenübers ein. Die Reflexion zeigte auf, wie stark unser Bild von Menschen durch erste Eindrücke geprägt ist.
- In der Übung „Such‘ das Vorurteil“ positionierten sich die Teilnehmenden zu Aussagen wie „Du bist ein Stadtkind“ oder „Du bist ein Landkind“. Anschließend sollten sie Vorurteile über die jeweils andere Gruppe benennen, diskutieren und dekonstruieren. Diese Übung machte deutlich, wie leicht Stereotype entstehen und wie wichtig es ist, sie zu hinterfragen.
- Ambiguitätstoleranz
Ambiguitätstoleranz bezeichnet die Fähigkeit, mehrdeutige Situationen und widersprüchliche Handlungsweisen zu ertragen.
- Übung „Irgendetwas stimmt hier nicht“
Mit ungewöhnlichen Kommunikationsanweisungen wie „Immer am Gesicht des Gegenübers vorbeischauen“ oder „Immer zehn Sekunden warten, bevor man spricht“ wurden Gesprächssituationen simuliert, die Verwirrung stifteten. Die Teilnehmenden reflektierten anschließend ihre Reaktionen und lernten, mit Mehrdeutigkeiten umzugehen. - Spiel „Billard der Begegnung“
Hier wurden an unterschiedlichen Tischen variierende Regeln eingeführt, die zu Beginn nicht kommuniziert wurden. Das bewusste Erleben von Verwirrung und die Suche nach Lösungen verdeutlichten die Herausforderungen interkultureller Begegnungen. Alternativ für Nicht-Billardspieler wurde das selbe Prinzip überraschender Regelwechsel auf ein interkulturelles Mau-Mau-Spiel angewandt.
- Eigen- und Fremdwahrnehmung
- Textarbeit „Meine eigene Herkunft“
Die Teilnehmenden lasen einen Text mit typischen Zuschreibungen für ärmere, unterentwickelte Länder. Am Ende waren sie überrascht zu erfahren, dass der beschriebene Kontext Deutschland betraf. Die Reflexion beleuchtete, wie stark wir kulturelle Stereotype verinnerlicht haben und wie oft wir diese nicht auf uns selbst, sondern nur auf andere beziehen. - Karte „Europe according to Germany“
Anhand einer humorvollen Karte diskutierten die Teilnehmenden Fremd- und Selbstbilder Deutschlands aus internationaler Perspektive. Dazu galt es, fremde Vorurteile in Bezug auf Deutschland einzuordnen und in Beziehung zu setzen zu den eigenen Vorurteilen anderen Menschen und Kulturen gegenüber. - Umdeuten
Die Teilnehmenden bekamen ein Arbeitsblatt mit mehrdeutig formulierten, tendenziell negativen Eigenschaften und sollten diese positiv umdeuten. Die Frage „Welche positiven Eigenschaften/Motivationen könnten hinter diesem Verhalten stecken?“ wurde zu einer Einladung zum Perspektivwechsel und zur kritischen Selbstreflexion.
Relevanz für den Sport und die Gesellschaft
Das Praxisprojekt von Stefanie Hanke zeigt überaus anschaulich und nachvollziehbar, wie Sportvereine zu Lernorten für interkulturelle Kompetenz werden können. Das Teilnehmenden-Feedback aus dem Billard-Sport fiel positiv aus: Die vorgestellten Übungen förderten auf spielerische und unterhaltsame Weise das Verständnis für kulturelle Unterschiede, stärkten die Teamarbeit und sensibilisierten für den Umgang mit Diversität – alles Voraussetzungen für eine vielfältige und respektvolle Gesellschaft. Und für ein gedeihliches Miteinander über kulturellen Grenzen hinaus im Sport.